Alles wird gut
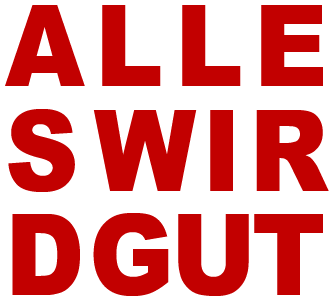
Ja. Wirklich alles.
Der obige Satz "Alles wird gut" drückt keine künftige Tatsache aus. Er beschreibt eine Einstellung. Und Einstellungen können Tatsachen schaffen. Das nennt man eine 'self-fulfilling prophecy'. Aber eigentlich ist der obige Satz nicht einmal die Beschreibung einer konkreten Einstellung. Er ist eher die Aufforderung zur Überprüfung der eigenen Einstellung.
Unsere Zeit - wobei 'unsere' inzwischen die gesamte Menschheit meint - ist keine optimistische, und dafür gibt es gute Gründe. Die Weltordnung versinkt stetig tiefer in Totalitarismus und zunehmender Gewalt. Politischer Wahnsinn, wie er sich inzwischen auch in den USA breitmacht, steht neben denkbar rücksichtslosester militärischer Gewalt im russischen Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine oder nunmehr auch im Sudan. Neben unzähligen weiteren Diktaturen in aller Welt steigt derweil in Ostasien wie ein riesiges, extraterrestriches Raumschiff der leuchtende Stern einer chinesischen Supermacht auf. Deren perfektionierte Methoden der Überwachung und Bestrafung von Gesinnungsabweichlern sind genauso alarmierend wie ihre wirtschaftliche Leistungskraft aufsehenerregend ist. Das Resultat dieser Entwicklung ist unter anderem, dass man die Startseiten der großen Nachrichtenportale nur noch in Erwartung neuer Katastrophennachrichten öffnen kann.
Narbengewebe
Das macht etwas mit uns, und zwar etwas sehr Ernstes. Es schüchtert uns ein, produziert eine generelle Weltangst, die weit über die aktuelle Gefahrenherde hinausgeht. Verschiedene Kulturen der Menschheit befanden sich schon früher in diesem erbarmungswürdigen Zustand. Insbesondere das christliche Mittelalter war eine zutiefst verängstigte Epoche infolge der überall herrschenden Willkür und Gewalt, periodisch über den Kontinent hinwegrasender Pestepidemien und einer Religion, die alles Diesseitige ohne Wenn und Aber verdammte. Sex war des Teufels, gewerblicher Fleiß und damit einhergehender wirtschaftlicher Erfolg betrugsverdächtig, Andersgläubige wurden massiv diskriminiert und Frauen und leibeigene Bauern sowie Sklaven wie Sachen behandelt. Speziell Frauen wurde gerade am Ende des Mittelalters, d.h. mit dem Anbruch der Neuzeit, obendrein zu Tausenden lebendig verbrannt, weil sie angeblich etwas mit dem Teufel hatten. Aber auch in anderen Kulturen ging es nicht sanfter zu. Die zur Zeit des europäischen Mittelalters in Mittelamerika herrschenden Azteken töteten bei rituellen Anlässen Tausende Gefangener, indem sie ihnen bei vollem Bewusstsein das Herz herausrissen, und im neu entstandenen chinesischen Reich der Jahre 221 ff. vor unserer Zeitrechnung unter der Chin-Dynastie herrschte eine Bestrafungsobsession, deren Grausamkeit selten von anderen Kulturen übertroffen worden sein dürfte. Von den Millionen Juden und anderen Opfern eines extremen Rassismus und Sozialdarwinismus, die während der Nazizeit nach ihrer Tötung in Gaskammern und industriellen Brennöfen wie Ungeziefer vernichtet wurden, gar nicht zu sprechen.
Dagegen schaut es in der heutigen Welt vergleichsweise zahm aus. Wir sollten uns allerdings nicht mit dem Schlimmsten vergleichen, was Menschen einander antun können. Umgekehrt hat es allerdings auch wenig Sinn, vor dem neuen Gewalt- und Herrschaftswahn, der sich derzeit auf der ganzen Welt ausbreitet, einfach die Augen zu verschließen. Was uns die Medien täglich bieten, ist leider bittere Wirklichkeit. Und es hilft auch nicht, in die christliche Metaphysik zurückzufallen, die uns bei entsprechend gottgefälliger Lebensführung zumindest nach dem Tode die Erlösung im himmlischen Paradies verspricht. Wer's glaubt, wird nicht selig, sondern hat nicht richtig nachgedacht.
Selbstheilung heißt...
Wie aber können wir dann dem fast unvermeidlichen Trauma entkommen, dass derartige Großereignisse in unseren Köpfen anrichten? Nun, wir müssen offenbar lernen, zumindest an das langfristig Gute zu glauben, auch wenn es offenbar keinen Gott gibt, der das für uns besorgt. Anderslautende Beteuerungen christlicher Würdenträger haben sich leider als haltlose Illusion entpuppt, gelegentlich auch als bequemes Mittel einer unverschämten Bereicherung eben jenes Klerus, der uns anderntags erzählt, wie sündig und schlecht wir allesamt sind. All das führt nur zu noch mehr Stress, zumal konkurrierende Religionen mit ganz anderen Göttern, Vorschriften, Drohungen und Missbräuchen ebenso obsessiv aufwarten. Vergessen wir das endlich. Sinnvoller wäre es, über neue Formen politische und sozialer Ordnung nachzudenken, jenseits der ausgetretenen Klischees von Kommunismus, Kapitalismus & Co.
Worauf aber kann sich ein Glaube oder eine Hoffnung, dass am Ende doch noch alles gut wird, dann stützen? Ich denke, dass wir uns bescheiden, aber beharrrlich, auf unsere eigenen Kräfte zum vernünftigen Denken besinnen sollten. Das klingt ähnlich der bekannten kantischen Definition von 'Aufklärung', ist im Detail aber doch anders. Wir haben inzwischen nämlich gelernt, dass 'der Mensch' (a) keineswegs vernünftig ist, wenn man ihn nur in Ruhe lässt, sondern häufig gerade dann höchst aggressiv und asozial wird, und (b), dass es keine individuelle Schuld gibt, wenn jemand noch nicht im erleuchteten Zustand aufgeklärter Vernunft ist. Wir arbeiten vielmehr gerade an jenem Fortschritt, und das ist keine Sache, die sich im Handumdrehen erledigen lässt.
... die Nerven zu behalten
Es geht also nicht um den Glauben an irgendeinen Gott oder ein frei erfundenes, gar esoterisches Weltenschicksal, sondern um das Vertrauen in sich selbst und die eigene menschliche Umgebung. Das verhält es sich eigentlich nicht anders als mit dem Glauben z.B. an die eigenen Körperkräfte oder die eigene Gesundheit: Man muss etwas dafür tun. Das steigert wiederum erheblich die Wahrscheinlichkeit, dass unser persönliches und gesellschaftliches Entwicklungsziel eines Tages wirklich wahr wird. "Alles wird gut" heißt, nicht den Mut zu verlieren. Und es heißt, selbst als Beispiel des Guten auftreten zu wollen - und dafür etwas zu tun. Bitte diese Aufforderung nicht mit missionarischem Überzeugungseifer verwechseln. Solche Leute sind total nervig. Nein; es geht tatsächlich darum, bei Sinnen zu bleiben, sich weder zu überschätzen noch in Depressionen zu verfallen und im entscheidenden Moment, nämlich dann, wenn um dich herum wirklich Verzweiflung ausbricht, die Nerven zu behalten. Gut nachdenken. Freundlich bleiben. Seine Wut mäßigen, wenn sie uns beim Einschlafen zu überwältigen droht. Am Tag denjenigen helfen, denen es psychisch nicht gut geht, weil sie an der Welt zerbrechen. Dann wird am Ende - sicherlich nicht morgen, vielleicht erst in Jahrhunderten, aber egal - tatsächlich alles gut. Oder zumindest ein bisschen besser, als es heute ist. (ws)